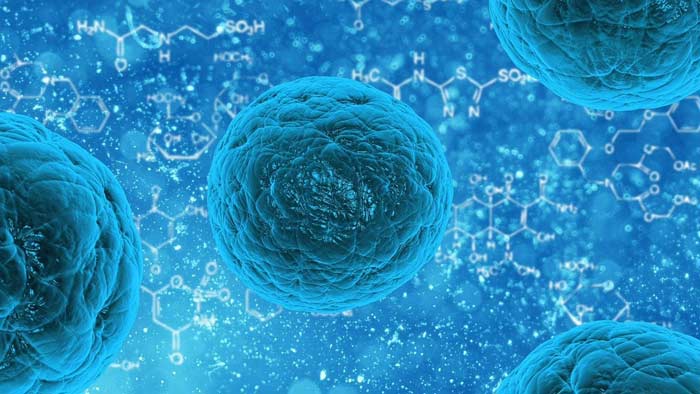
Meldungen über Tuberkulose in einer Zeit modernster medizinischer Versorgung sind eine große Überraschung. Wie sicher sind wir vor Bakterien, die man längst besiegt zu haben glaubte?
Ob die Medizin uns vollständig schützen kann? Unsere Meinung: Zweifel sind erlaubt.
Von Jerold Aust
Die Folgen von Nahrungsmittelvergiftung lassen sich nicht mehr nur auf Bauchschmerzen begrenzen. Die sechzehn Monate alte Anna Grace Gimmestad aus dem Dorf Evans im amerikanischen Bundesstaat Colorado trank gern Obstsäfte. Bei Einkaufsgängen mit ihrer Mutter wurde das kleine Mädchen von den bunten Flaschen in den Supermarktregalen in helle Erregung versetzt.
Ende 1996 wurde Anna nach dem Verzehr von Apfelsaft krank. Nach zwei Wochen versagten ihre Nieren, ihr Herz stockte, und sie starb. Der Saft war durch einen Krankheitserreger verseucht, der in den USA immer häufiger zur Gefahr wird: einen Stamm des Bakteriums Escherichia coli, der unter der Bezeichnung „0157.H7“ firmiert.
Dieser tödliche Bazillus ist öfter in Obstsäften und frischem Gemüse in den USA aufgetaucht. (Damit soll aber keineswegs vor dem Verzehr dieser Nahrungsmittel gewarnt werden. Dafür ist die Häufigkeit der Verseuchung noch zu gering.)
An die 20 000 Amerikaner werden jährlich durch Escherichia coli infiziert, hauptsächlich durch Fleischverzehr. In etwa 500 dieser Fälle tritt der Tod ein. Die Variante 0157.H7 wurde zuerst im Jahre 1980 in Speisen gefunden. Seither macht sie sich in immer häufiger auftretenden Wellen bemerkbar.
Obwohl die Nahrungsmittelversorgung in den USA zu den sichersten der Welt zählt, schlüpfen immer noch hartnäckige Krankheitserreger durch die Löcher. Leichte Unaufmerksamkeiten können tödliche Folgen haben. Es wird angenommen, daß die Äpfel, die den Rohstoff des Saftes gebildet hatten, der die kleine Anna ums Leben brachte, auf den Erdboden gefallen und mit Wildkot in Berührung gekommen waren. Wären die Hygienevorschriften beachtet worden, hätte man die Tragödie verhindert.
Haben wir es hier mit einem seltenen Einzelfall zu tun, oder gibt es vielleicht andere gefährliche Erreger, die den Schutzwall zu durchdringen vermögen, mit dem uns – wie wir hoffen – Wissenschaft und Medizin umgeben haben?
In neuerer Zeit wurden beunruhigende Berichte veröffentlicht, nach denen Mikroorganismen unsere Abwehrmaßnahmen vereiteln, indem sie sich zu Stämmen mutieren, gegen die unsere stärksten antibiotischen Waffen machtlos sind. Zu diesen Erregern gehören Todbringer wie Tuberkulose, die Beulenpest und Staphylokokken.
Kampf gegen die Keime
Bis vor knapp zwei Jahrzehnten ließen sich die meisten Staphylokokkeninfektionen mit Antibiotika behandeln, wobei das wirksamste Mittel Methicillin hieß. Doch Anfang der 80er Jahre tauchte ein Staphylokokkenstamm auf, der dieser Schutzwaffe überlegen war.
Inzwischen haben sich mehrere solcher Stämme entwickelt, und Methicillin ist heute gegen die Hälfte aller Staphylokokkeninfektionen unwirksam. Die ständigen Mutationen bei den Krankheitserregern zwingen Mediziner dazu, immer neuere Antibiotika zu entwickeln. Aber in diesem Wettlauf ist es schwierig, Schritt zu halten: Auch gegen neue Medikamente sind manche Staphylokokkenstämme resistent. Überhaupt scheint der Mensch im Kampf gegen Bakterien ins Hintertreffen zu geraten. Selbst Vancomycin, die jüngste Wunderwaffe unter den Antibiotika, scheint wegen der Entstehung neuer Bakterienstämme an Wirksamkeit zu verlieren. Die Vorstellung, Bakterien seien schon von der Wissenschaft besiegt worden, könnte sich noch als Illusion erweisen.
„In den nächsten Jahren ist mit der Entwicklung neuer Medikamente vom Schlage eines Vancomycin nicht zu rechnen“, konstatiert Stuart Levy, Leiter des Zentrums für Anpassungsgenetik und Drogenresistenz an der medizinischen Fakultät der Tufts-Universität in Boston, USA.
Ein besorgniserregender Fall
Ein Fall aus dem amerikanischen Bundesstaat Michigan läßt vielleicht erahnen, welche Herausforderungen der Medizin bevorstehen. Das ist zumindest die Ansicht der örtlichen Gesundheitsbehörden, die über eine Zunahme der Häufigkeit neuer Resistenzfälle in aller Welt zu berichten wissen. Es ging um einen Patienten, der regelmäßig zu Hause an einem Dialysegerät angeschlossen war, weil seine Nieren nicht funktionierten. Die Dialyse, ein Blutreinigungsvorgang, erfordert das Einstecken einer Kanüle in den Bauch des Patienten. Da das die Gefahr einer Infektion erhöht, wird die Dialyse mit Gaben von Vancomycin begleitet. In diesem Fall wurde der Kranke trotz dieser Maßnahme mit Staphylokokken infiziert. Es war das erste Mal in den USA, daß Staphylokokken Vancomycin überwunden hatten. Bisher war nur ein Fall aus Japan bekannt.
Untersuchungen am Zentrum für Krankheitsbekämpfung und -verhütung („Centers for Disease Control and Prevention“, CDC) in Atlanta (USA) zeigten, daß der Patient mit einer neuen Variante des Staphylococcus aureus infiziert worden war, einem Bakterium, das weit und breit vorkommt und sich in Krankheiten äußert, die von Pickeln und Furunkeln zu tödlichen, nachoperativen Blutvergiftungen reichen. Vancomycin ist nicht mehr die Wunderwaffe, die es einmal war.
Zu starke Geschütze im Einsatz?
Der geschäftsführende Leiter der CDC-Klinik für Infektionskrankheiten, der Epidemiologe William Jarvis, führt die Entwicklung des neuen Staphylokokkenstammes darauf zurück, daß viele Ärzte Vancomycin verschreiben, wenn schwächere Medikamente ausreichen würden. Je mehr ein Bakterium mit einem bestimmten Antibiotikum in Berührung kommt – so Jarvis –, desto mehr Gelegenheiten hat es, resistente Stämme zu entwickeln.
„An manchen Dialysezentren gilt es als selbstverständlich, daß Vancomycin eingesetzt wird, sobald ein Patient Schmerzen an der Katheterstelle spürt, an Fieber leidet oder irgendwelche andere Symptome zeigt“, sagt Jarvis. „Diese Praxis muß unbedingt aufhören. Wir haben bereits die Empfehlung ausgesprochen, schwächere Antibiotika einzusetzen, sofern sie mit den betreffenden Bakterien fertig werden.“
Anthony S. Fauci, Chefarzt am Nationalen Institut für Allergie- und Infektionskrankheiten („National Institute of Allergy and Infectious Diseases“), sieht die Sache mit Vancomycin anders: Bei schwerkranken Patienten, die einer dringenden Behandlung bedürfen, „muß man gleich schweres Geschütz auffahren, wenn man kein Risiko eingehen will.“
Wenn Untersuchungen aber zeigten, daß leichtere Waffen ausreichend sein dürften, könne man oft zu einem schwächeren Medikament wechseln. Somit könne Vancomycin für Notfälle reserviert werden.
Zum ersten Mal in der Geschichte der USA haben Wissenschaftler einen Staphylokokkenstamm ausgemacht, der Vancomycin überlegen ist. Bisher konnte dieses Medikament mit jedem Staphylokokkenstamm aufräumen.
Viele Ärzte setzen nun ihre Hoffnung auf Synercid, ein in Frankreich entwickeltes Antibiotikum. Aber dieses Mittel ist längst kein Patentrezept. In manchen Studien hat es sich sogar im Vergleich mit bekannten Antibiotika als weniger wirksam gezeigt.
Die häufigen Mutationen von Bakterien und Viren sind es, die den Kampf gegen das AIDS-Virus (HIV) erschweren. Bis ein Gegenmittel jeweils entwickelt, geprüft und eingesetzt wird, sind bereits neue Stämme vorhanden, denen es nichts anhaben kann.
Steigende Resistenz – was tun?
Trotz allem gibt es auch ermutigende Tendenzen im Kampf gegen resistente Mikroorganismen. Studien in Finnland haben gezeigt, daß eine Änderung des Verhaltens von Arzt und Patient die Verbreitung resistenter Mutanten eindämmen kann. Ähnliches wird aus New York gemeldet, wo Verhaltensänderungen dazu geführt haben, daß die Entstehungsgeschwindigkeit resistenter Tuberkulosebazillen dramatisch zurückgegangen ist.
Auf der anderen Seite verlassen sich viel zu viele Leidende auf eine Heilung durch Antibiotika. In den USA ist ein Viertel aller Streptokokkus-Pneumoniae-Bakterien – das sind die Bakterien, die für Ohreninfektionen, Lungenentzündung und Meningitis verantwortlich sind – gegen Penicillin resistent. Längere Krankenhausaufenthalte und eine höhere Sterblichkeitsrate, vor allem in Krankenhäusern, sind das Ergebnis.
Wenn sich die Resistenz gegen Vancomycin unter den Staphylokokken verbreitet, wird die Lage nach Expertenmeinung schlimm aussehen. „Das müssen wir uns bewußt machen, bevor wir mit unserem Latein am Ende sind“, warnt Morton N. Schwarz, Professor für Medizin an der Universität Harvard.
Patienten und Ärzte sind nicht die Einzigen, die sich überlegen sollten, ob der überhöhte Einsatz von Antibiotika wirklich vernünftig ist. Denn in den frühen achtziger Jahren wurden die in den USA hergestellten Antibiotika zu vierzig Prozent an Tiere verabreicht. Auch in der Obstzucht werden solche schweren Mittel verwendet. Von den 16 000 Tonnen an Antibiotika, welche die Amerikaner während jenes Zeitraumes produzierten, wurden etwa 150 Tonnen auf Birnen, Äpfel und andere Obstsorten gespritzt, angeblich zum Schutz der Früchte vor einer Hautfäulnis.
„Wir überziehen die Welt mit einer dünnen Schicht von Antibiotika, die zur Förderung resistenter Bakterien führt“, erklärt David L. Heymann, Leiter der Abteilung für entstehende Krankheiten bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Medikamente stellen einen Eingriff in die Umwelt der Bakterien dar. Sie merzen empfindliche Varianten aus und verschaffen so den resistenteren Bazillen einen Überlebensvorteil. Damit kommt es zur Verbreitung von immer stärkeren Krankheitserregern, die eine ganze Gesellschaft bedrohen können. Somit leuchtet ein, warum manche zu einem bescheideneren Gebrauch von Antibiotika raten.
Am Zentrum für Krankheitsbekämpfung und -verhütung wird geschätzt, daß von den 150 Millionen Rezepten für Antibiotika, die jährlich für amerikanische Patienten in ambulanter Behandlung geschrieben werden, über 50 Millionen überflüssig sind. Wenn man allein diese unnötigen Verschreibungen vermiede, würde man die Entstehungshäufigkeit immer resistenterer Bakterien und Viren erheblich einschränken. Auf der anderen Seite, wenn wir das nicht tun, könnte es sein, daß wir flächendeckende Seuchen heraufbeschwören, wie wir sie seit dem Mittelalter nicht mehr erlebt haben.
Neue Bedrohung durch Malaria
Malaria, eine Krankheit, die durch tropische Moskitos übertragen wird, ist wieder auf dem Vormarsch. Malaria befällt den Menschen über die Blutbahn und wird von einem infizierten weiblichen Moskito übertragen, der unter dem Namen Anopheles (griechisch für „schädlich“) firmiert. Hauptsymptom ist schwerer Schüttelfrost. Unbehandelt verläuft Malaria meistens tödlich. Am Härtesten trifft sie Kleinkinder und Schwangere. Seit zehn Jahren erlebt man, daß das Leiden in Gebieten auftaucht, in denen es bisher unbekannt war oder als gebannt galt.
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehen jährlich weltweit zwischen 1,5 und 2,7 Millionen Todesfälle auf das Konto dieser Krankheit, die jedes Jahr zwischen 300 und 500 Millionen Menschen befällt. Neun von zehn Erkrankungs- bzw. Todesfällen ereignen sich in Afrika südlich der Sahara, wo manche Gegenden eine Versiebenfachung der Fälle innerhalb der letzten Jahre erlebt haben.
„Wenn man in einem afrikanischen Dorf lebt, hat man Tag für Tag mit Malaria zu tun“, stellt Trenton Ruebush, Leiter der Malaria-Abteilung am Zentrum für Krankheitsbekämpfung und -verhütung (CDC) in Atlanta (USA) fest. „Die Menschen haben sich damit abgefunden, daß sie und ihre Kinder mehrmals im Jahr an Malaria erkranken werden. Dieses Leiden ist in dieser Region ein gewaltiges Problem, das man nur mit großen Anstrengungen wird merklich lindern können.“
Eine andere Weltgegend, die auch schon immer mit Malaria zu kämpfen hatte, ist der aus Indien, Pakistan und Sri Lanka bestehende indische Subkontinent. „Jahrelang hatten die Staaten in dieser Gegend die Krankheit ziemlich im Griff“, so Ruebush. „Doch durch Mittelkürzungen, Nachlässigkeit und steigende Resistenz verzeichnet man in den letzten zehn Jahren eine erhebliche Ausbreitung der Malaria in diesen Gebieten.“
Malaria auf dem Vormarsch
Auch in den Industrieländern, wie z. B. in Europa und den Vereinigten Staaten, wo sie früher unbekannt war, ist Malaria auf dem Vormarsch. In den USA werden jährlich zwischen 1000 und 2000 Fälle gemeldet. Das Zentrum für Krankheitsbekämpfung und -verhütung meint aber, daß die Dunkelziffer genauso hoch sein dürfte. In 97 Prozent dieser Fälle werde die Krankheit entweder durch Amerikaner, die von einer Auslandsreise zurückkehren, oder durch ausländische Reisende, die Amerika besuchen, in die USA gebracht. Da sich die Symptome nicht sofort zeigen, wissen viele Reisende nicht, daß sie die Krankheit von Land zu Land tragen. Nach CDC-Angaben werden aber immer mehr Menschen innerhalb der Vereinigten Staaten angesteckt. Hauptübertragungswege sind Bluttransfusionen, Organverpflanzungen und die Verwendung infizierter Spritznadeln durch Rauschgiftsüchtige.
Ruebush meint, es habe schon Ansteckungen durch in den südlichen US-Bundesstaaten lebenden Moskitos gegeben, doch sei die Gefahr einer Malaria-Epidemie in Amerika sehr gering. „Es müßten viele Faktoren zusammenkommen“, erklärt er. „Ein Moskito müßte zuerst einen Malariakranken stechen. Die Witterung müßte dem Insekt außerdem erlauben, so lange am Leben zu bleiben, bis die krankheitserregenden Schmarotzer sich in seinem Leib entwickelt haben. Dann müßte der Moskito einen weiteren Menschen stechen, um die Erreger zu übergeben. Dieser Mensch müßte dann von einem anderen Moskito gestochen werden, und so weiter.“
Der Kampf geht weiter
Wissenschaftler bei der WHO und dem CDC sind dabei, mehrere Impfstoffe gegen Malaria zu entwickeln, und hoffen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren am Ziel zu sein. Auch Medikamente zur Behandlung von Malaria werden neu bzw. weiterentwickelt. Eine weitere Maßnahme zur Eindämmung von Malaria ist die Verwendung von Malarianetzen, die mit einem Insektenvernichtungsmittel getränkt sind.
„Es fehlt uns nicht an Bekämpfungsmethoden“, stellt Ruebush fest. „Der Haken liegt darin, daß gerade die Gegenden, wo Hilfe not tut, schwer zugänglich sind. Außerdem ist dort nicht genug Kaufkraft vorhanden, um die Medikamente zu bezahlen. Das Problem ist also eher verwaltungstechnischer, logistischer Natur.“
Die gefährlichste Krankheit der Welt
Es handelt sich um eine Seuche unvergleichlichen Ausmaßes, die mehr Erwachsene dahinrafft als alle anderen Infektionskrankheiten zusammen. Es wird geschätzt, daß die Hälfte aller Flüchtlinge daran leiden. Sie bringt mehr AIDS-Kranke um als jede andere Störung und macht mehr Kinder zu Waisen als jede andere ansteckende Krankheit. Es geht nicht um AIDS, Hepatitis oder Malaria, sondern um eine altbekannte Geißel, die beinahe vor einer Generation besiegt worden wäre: Tuberkulose.
Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sind fast zwei Milliarden Menschen – ein Drittel der Weltbevölkerung – mit dem Tb-Bazillus infiziert.
Jedes Jahr sind acht Millionen neue Tb-Erkrankungen und drei Millionen Tb-Todesfälle zu verzeichnen. Wenn die gegenwärtigen Tendenzen anhalten, werden nach WHO-Schätzungen bis zu 500 Millionen Menschen innerhalb der nächsten fünfzig Jahre von Tuberkulose befallen werden.
Tuberkulose ist nicht auf die Entwicklungsländer beschränkt. Es wird geschätzt, daß zwischen zehn und fünfzehn Millionen Amerikaner Träger des Tb-Bakteriums sind und daß 22 000 neue Fälle jedes Jahr hinzukommen.
Noch vor 15 Jahren waren die Gesundheitsbehörden fast soweit, Tuberkulose neben Pocken und Kinderlähmung für endgültig besiegt zu erklären. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Tuberkulose die häufigste Todesursache in den USA. In den 1940er Jahren wurden Antibiotika entwickelt, mit denen sich die Krankheit bekämpfen ließ. Bis in die achtziger Jahre hinein war die Krankheit auf dem Rückzug.
Doch in den achtziger Jahren wendete sich das Blatt. Sowohl in den Industriestaaten als auch in den Entwicklungsländern wurde eine Zunahme der Tb-Fälle registriert. In den USA betrug die Zunahme zwischen 1985 und 1992 fast 20 Prozent. Im Jahre 1993 veranlaßte die neue Tb-Seuche die WHO, zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen weltweiten Notstand auszurufen. Denn mehr Erwachsene fielen der Tuberkulose zum Opfer als bei AIDS, Malaria und sämtlichen Tropenkrankheiten zusammengenommen.
Der Tb-Bazillus heißt Myobacterium tuberculosis. Die Übertragung geschieht durch Einatmung infizierter Stoffe, die ein anderer – zum Beispiel durch Husten, Niesen, Rufen oder Lachen – ausgestoßen hat. Wer in der Nähe ist, kann sich den Erreger einfangen.
Bei den meisten Menschen, die sich so eine Infektion holen, ist das Immunsystem stark genug, um einen Ausbruch der Krankheit zu verhindern. Die Bakterien bleiben im Körper, werden aber in Schach gehalten. Symptome zeigen sich nicht, und die Infektion wird nicht weiter getragen. Aber sogar nach Jahrzehnten kann es trotzdem zu einem Aufflammen der Symptome kommen, wenn das Immunsystem aus irgendeinem Grund dann doch geschwächt wird. Ungefähr zehn Prozent aller Infizierten erleben einen Ausbruch der Krankheit.
Meistens sind es die Lungen, die von Tuberkulose betroffen sind, doch auch andere Organe können in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn sich die Bakterien in den Lungen vermehren, können sie vom Blut zu anderen Körperteilen wie den Nieren, der Wirbelsäule und dem Gehirn transportiert werden. Eine Ansteckungsgefahr besteht meistens aber nur, wenn sich die Bazillen in den Lungen oder im Rachen festsetzen.
Die gewöhnlichsten Symptome der Krankheit sind allgemeine Müdigkeit und Schwäche, extremer Gewichtsverlust, Fieber und nächtliche Schweißausbrüche. Bei einem Fortschreiten der Erkrankung kann es außerdem zu Dauerhusten, Brustschmerzen, Blutspucken und Kurzatmigkeit kommen.
Weil der Hauptübertragungsweg die Luft ist, kann sich jeder infizieren. Am höchsten gefährdet sind Arme und Obdachlose, sowie Leute mit einem unterentwickelten oder geschwächten Immunsystem: Kleinkinder, Senioren, HIV-Infizierte und manche Krebskranke.
Neue, tödliche Stämme
Gesundheitsbehörden machen sich zunehmend Sorgen angesichts der Entstehung neuer, drogenresistenter Tb-Stämme. Nach Angaben der WHO treten solche Stämme überall in der Welt auf und lassen das Gespenst einer weltweiten Seuche aufkommen, gegen die keine große Hilfe zu erwarten ist.
Resistente Stämme sind in Gefängnissen in New York, in einem Mailänder Krankenhaus und an vielen Orten dazwischen aufgetreten. „Jeder, der irgendwo auf der Welt Luft einatmet, ist grundsätzlich gefährdet“, stellt Arata Kochi, Leiter der Tb-Bekämpfung bei der WHO, fest.
Nach einer Umfrage, die im Oktober 1997 von der WHO, dem CDC und der Internationalen Union gegen Tuberkulose und Lungenkrankheiten veranstaltet wurde, sind an die 50 Millionen Menschen mit einer Art von Tuberkulose infiziert, die gegen Medikamente resistent ist. In vielen dieser Fälle wäre sogar eine gleichzeitige Behandlung mit mehreren Standardmedikamenten aussichtslos. In den Entwicklungsländern, wo die meisten Fälle mehrfacher Resistenz vorkommen, verläuft die Krankheit meistens tödlich.
„Die Welt wird kleiner und die Tb-Keime werden stärker“, konstatiert Kochi. „Die Welt erkennt nur langsam die Folgen der dramatischen Zunahme des internationalen Reiseverkehrs. Erst in letzter Zeit dämmert es den Regierungen der reichen Länder, daß die Unfähigkeit ärmerer Staaten, die Tuberkulose im Griff zu behalten, auch für ihre Bürger eine Bedrohung darstellt.“
Die WHO-Studie identifiziert die Gebiete, von denen die Bedrohung einer weltweiten Tb-Epidemie ausgeht. In diesen Gegenden leben 75 Prozent aller Tb-Kranken. Zu den betroffenen Ländern gehören Rußland, Bangladesch, Brasilien, China, Äthiopien, Indien, Indonesien, Mexiko, Pakistan, die Philippinen, Südafrika, Thailand und der Kongo.
Viele der betreffenden Gebiete sind regionale Drehpunkte für internationale Urlaubs-, Geschäfts- und Umsiedlungsreisen. WHO-Vertreter räumen ein, daß man eine internationale Ausbreitung resistenter Tb-Stämme kaum verhindern kann.
Nach WHO-Angaben beherbergt ein Drittel aller Staaten in der Welt mindestens einen Tb-Stamm, der mehrfach resistent ist. Zur Zeit seien zwar erst zwischen zwei und vierzehn Prozent aller Tb-Fälle unheilbar, dennoch könne es zu einer schnellen Verbreitung einer unheilbaren Tuberkulose kommen, weil nur einer von zehn Patienten in den Genuß einer Behandlung kommt, die mit Drogenresistenz fertig wird.
Resistente Tb-Stämme entwickeln sich, wenn Patienten ihre Medikamente nicht vorschriftsgemäß einnehmen. So ist eine Heilung in manchen Fällen durch die gleichzeitige Einnahme von vier Medikamenten über einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten möglich. Weil die Symptome aber schon nach zwei bis vier Wochen verschwinden, hören manche Patienten mit der Einnahme auf, bevor alle Tb-Bakterien in ihrem Körper abgetötet worden sind. Die überlebenden Bakterien vermehren sich, wobei auch Mutanten entstehen, die den Medikamenten überlegen sind.
Zur Diagnose von Tuberkulose stehen mehrere Methoden zur Verfügung. Eine Röntgenaufnahme der Lunge kann Beweise für aktive und inaktive Tb-Bazillen liefern. Die Bakterien lassen sich auch im Auswurf unter dem Mikroskop identifizieren. Aber erst das Anlegen einer Kultur in einer Sputumprobe liefert den endgültigen Beweis einer Tb-Infektion.
Mehrere Hauttests werden in der Tb-Diagnostik eingesetzt. Dazu gehören die Mantoux-, die Tine- und die PPD-Prüfung. Es werden jeweils tote Tb-Bakterien unter die Haut geschoben. Wenn keine Tb-Infektion besteht, werden keine Veränderungen an der Prüfstelle sichtbar. Andernfalls kommt es zwischen 48 und 72 Stunden nach dem Test zu einer Rötung und Schwellung an der Prüfstelle.
Wirksame Behandlungsmethoden
Nach Meinung mancher Gesundheitsbehörden ist es am Besten, wenn ein Tb-Patient seine Medikamente unter strenger Aufsicht einnimmt. Dadurch wird eine vollständige Heilung gewährleistet und die Entstehung neuer Resistenzen verhindert.
Nach Angaben der WHO wird solche Disziplin nur zehn Prozent aller Tb-Leidenden auferlegt. Dabei könnten bei Anwendung dieser Methode drei von vier Fällen vollständig geheilt werden.
„Die Tb-Seuche muß global bekämpft werden, wenn wir uns im eigenen Land schützen wollen“, sagt Kochi. „Es liegt im Interesse der reichen Länder, die weniger entwickelten Staaten im Kampf gegen die Tuberkulose zu unterstützen, bevor sie selbst zum Schauplatz des Geschehens werden.“ Die Entdeckung von Tb-Infizierten im Herbst 2000 an der Universität Trier bestätigt Kochis Ermahnung, zumal die Tb-Bazillen Anzeichen von Resistenz aufwiesen.